Warum klassische Website-Projekte scheitern
Noch immer laufen viele Website-Projekte nach demselben Muster ab: Ein Unternehmen merkt, dass die Website veraltet aussieht oder nicht mehr den aktuellen Markenrichtlinien entspricht. Es wird ein Redesign-Projekt gestartet, eine Agentur beauftragt, ein neues Design entworfen, entwickelt – und nach dem Launch ist das Thema für die nächsten zwei bis drei Jahre abgehakt.
Auf den ersten Blick wirkt dieser Ablauf effizient. Es gibt einen klaren Startpunkt, ein definiertes Budget, einen Launch-Termin und danach geht es „zurück zum Tagesgeschäft“. Aber genau hier liegt der Denkfehler: Eine Website ist kein Plakat, das man einmal aufhängt und dann in Ruhe lässt. Sie ist ein dynamischer Teil der Unternehmensstrategie, der jeden Tag neue Besucher empfängt, neue Touchpoints erzeugt und neue Chancen – oder auch Hürden – schafft.
Das sehen wir immer wieder, wenn Unternehmen zum ersten Mal auf uns zukommen. Häufig existieren keine klaren Ziele, was die Website eigentlich erreichen soll. Stattdessen hören wir vage Formulierungen wie „soll modern aussehen“ oder „soll mehr Leads generieren“. Aber was bedeutet das konkret? Wie viele Leads sollen es sein? Mit welcher Qualität? Bis wann? Ohne eine präzise Zieldefinition bleibt unklar, woran man den Erfolg überhaupt messen soll.
Noch problematischer ist, dass die meisten Websites nach dem Launch einfach sich selbst überlassen werden. Es gibt keine regelmäßige Erfolgskontrolle, keine Iterationen, keine Tests. Die Website bleibt unverändert, bis sie nach einigen Jahren wieder „veraltet“ wirkt – und der Zyklus von vorne beginnt. In dieser Zeit entgehen dem Unternehmen unzählige Optimierungsmöglichkeiten: bessere Conversion-Rates, mehr qualifizierte Bewerbungen, effizientere Customer Journeys.
Und schließlich beobachten wir, dass viele Unternehmen versuchen, gleich eine „perfekte“ Website zu bauen. Sie starten mit einem riesigen Scope, unzähligen Unterseiten, komplexen Features – ohne jemals eine Hypothese zu testen oder Nutzerfeedback einzuholen. Das führt zu hohen Kosten, langen Projektlaufzeiten und dem Risiko, am Ende eine schöne, aber strategisch ineffektive Website zu haben.
Unsere Lösung: Das Website as a Product Framework
Um genau diese Probleme zu lösen, haben wir bei Klarkode das Website as a Product Framework entwickelt. Es ist kein klassischer Projektplan, sondern ein strategisches Denkmodell, das Unternehmen hilft, ihre Website wie ein lebendiges Produkt zu behandeln – also wie ein System, das kontinuierlich gemessen, verbessert und an veränderte Markt- oder Nutzerbedürfnisse angepasst wird.
Im Kern geht es um einen Paradigmenwechsel: Weg von „wir launchen eine Website und sind fertig“, hin zu „wir entwickeln eine Website als Produkt, das sich mit unserem Unternehmen weiterentwickelt“.
In den folgenden Kapitel haben wir die wichtigsten Phasen des Frameworks zusammengefasst.
Zieldefinition – der Ausgangspunkt für alles
Jede erfolgreiche Produktentwicklung beginnt mit der Frage: Was wollen wir erreichen? Genau so muss auch jedes Website-Projekt starten. Wir definieren gemeinsam mit dem Kunden konkrete, messbare Ziele. Dabei nutzen wir eine Archetyp-Kategorisierung, um zu verstehen, welche Hauptfunktion die Website erfüllen soll:
Soll sie vor allem Leads generieren? Neue Talente anziehen? Marktinteresse validieren, weil ein neues Produkt getestet wird? Oder dient sie primär dazu, Reichweite und Sichtbarkeit zu erhöhen?
Erst wenn dieser Zweck klar ist, formulieren wir konkrete SMART-Ziele – also spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und terminiert. Statt „mehr Leads“ steht dann dort zum Beispiel:
„Wir wollen innerhalb von sechs Monaten die Zahl der qualifizierten Demo-Anfragen um 40 % steigern.“
Solche Ziele sind nicht nur viel präziser, sie machen es auch möglich, im weiteren Prozess zu überprüfen, ob die Maßnahmen tatsächlich wirken.
Strategie und Hypothesen – von der Idee zum Plan
Nach der Zieldefinition übersetzen wir diese in eine Produktstrategie. Ein zentrales Werkzeug dabei sind Hypothesen. Anstatt auf Bauchgefühl zu vertrauen, formulieren wir Annahmen, die getestet werden können:
„Wenn wir Social-Proof-Elemente (z. B. Kundenlogos und Testimonials) oberhalb der Falz auf der Pricing-Page platzieren, steigt die Conversion-Rate von Mid-Market-Kunden um 20 %, weil sie schneller Vertrauen fassen.“
Solche Hypothesen zwingen uns, klare Entscheidungen zu treffen: Was wollen wir ändern? Für wen? Welches Verhalten erwarten wir? Und warum glauben wir, dass das funktioniert?
Damit diese Hypothesen nicht im luftleeren Raum stehen, sammeln wir Daten: Wir führen Stakeholder-Interviews, um die internen Ziele zu verstehen. Wir analysieren Konkurrenten und deren Websites, um Best Practices und Lücken zu identifizieren. Wir erstellen Personas und User Journeys, um zu verstehen, welche Informationen Nutzer in welcher Phase brauchen.
Ergebnis ist ein klarer Aktionsplan, der nicht nur beschreibt, was gebaut werden soll, sondern auch warum.
Iterative Umsetzung – der Weg zum Produkt
Jetzt beginnt die Umsetzung – aber nicht als Wasserfallprojekt, sondern iterativ. Zuerst entwickeln wir ein Konzept, das Narrative, Content-Struktur und zentrale Interaktionen definiert. Danach folgen Wireframes, die Informationsarchitektur und Userflows sichtbar machen.
Erst dann starten wir mit Design und Entwicklung. Das Ergebnis ist eine erste Version der Website, die die wichtigsten Ziele abdeckt – ein MVP, wenn man so will. Diese Version geht so früh wie möglich live, damit echte Daten gesammelt werden können.
Parallel dazu setzen wir ein Tracking Layer auf, um die definierten KPIs zu messen. Von Anfang an wissen wir, welche Metriken beobachtet werden, und können sofort nach dem Launch erste Erkenntnisse gewinnen.
Review und Lernen – die Website wird intelligent
Nach dem Launch beginnt der spannendste Teil: das Lernen. Wir werten aus, wie sich Nutzer auf der Website verhalten. Heatmaps, Funnel-Analysen, Session-Recordings und qualitative Nutzerinterviews zeigen uns, wo es hakt, welche Inhalte gut funktionieren und welche vielleicht angepasst werden müssen.
Diese Daten sind die Grundlage für die nächste Iteration. Statt zu raten, was verbessert werden könnte, treffen wir Entscheidungen auf Basis von Evidenz.
Kontinuierliche Verbesserung – der Zyklus schließt sich
Eine gute Website ist nie „fertig“. Sie entwickelt sich kontinuierlich weiter, genau wie ein erfolgreiches Produkt. Neue Features werden getestet, Inhalte ergänzt oder aktualisiert, Layouts angepasst.
Wir pflegen dafür einen Growth Learning Backlog, in dem alle Hypothesen, Ergebnisse und nächsten Schritte dokumentiert werden. Dieser Backlog ist nicht nur ein Taskboard, sondern das Gedächtnis des gesamten Projekts – er sorgt dafür, dass nichts vergessen wird und alle Learnings in zukünftige Iterationen einfließen.
So entsteht ein Kreislauf aus Messen → Lernen → Optimieren, der die Website von einem statischen Asset zu einem lebendigen, strategischen Werkzeug macht.
Fazit: Websites als Wachstumshebel
Die Zeiten von „Launch & Forget“ sind vorbei. Eine moderne Website ist kein einmaliges Projekt, sondern ein strategischer Growth-Driver. Sie kann Leads generieren, Bewerbungen steigern, Vertrauen aufbauen – aber nur, wenn sie kontinuierlich gemessen und verbessert wird.
Unternehmen, die ihre Website wie ein Produkt behandeln, profitieren mehrfach: Sie lernen schneller, treffen bessere Entscheidungen, investieren ihr Budget gezielter und bauen einen langfristigen Wettbewerbsvorteil auf.







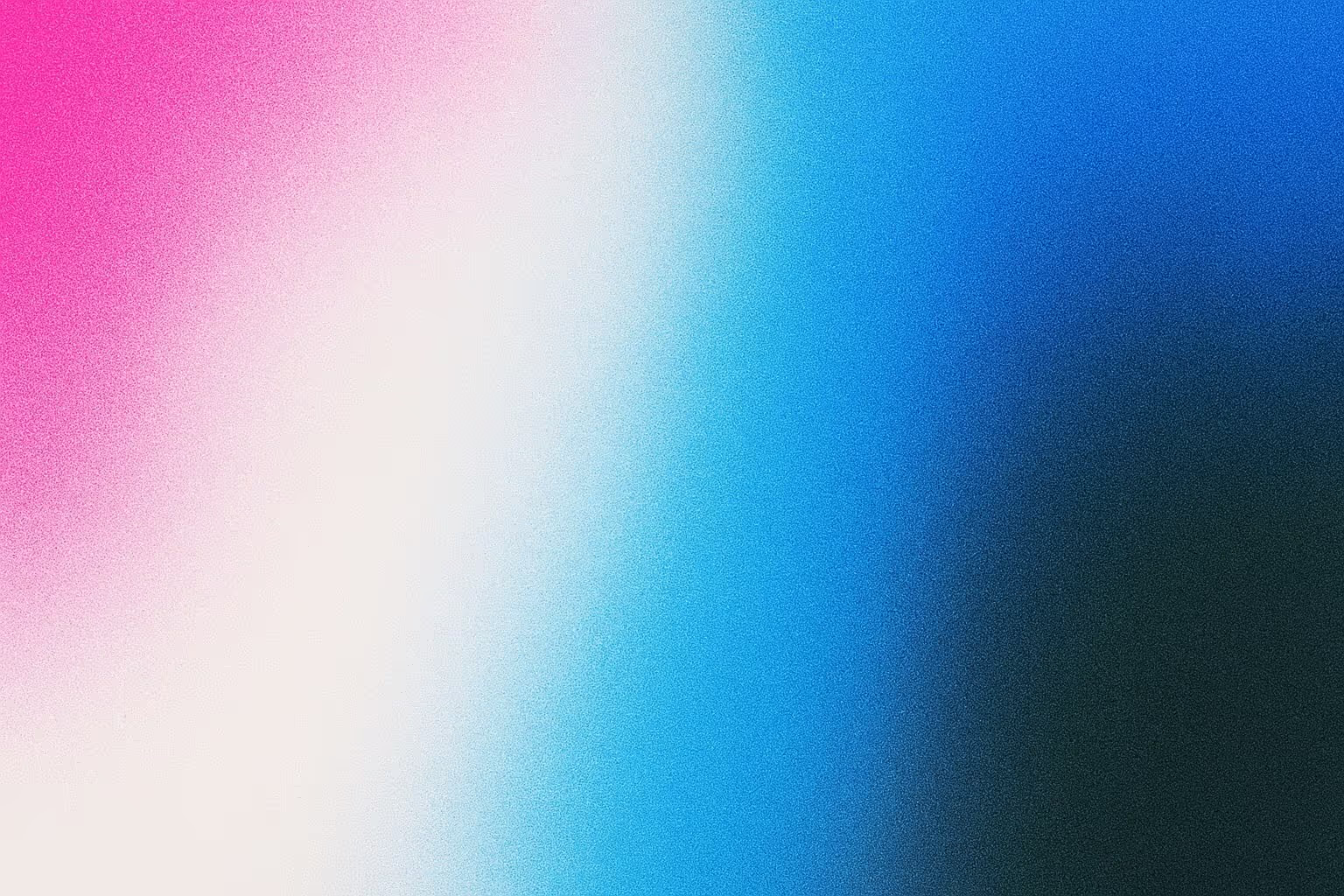
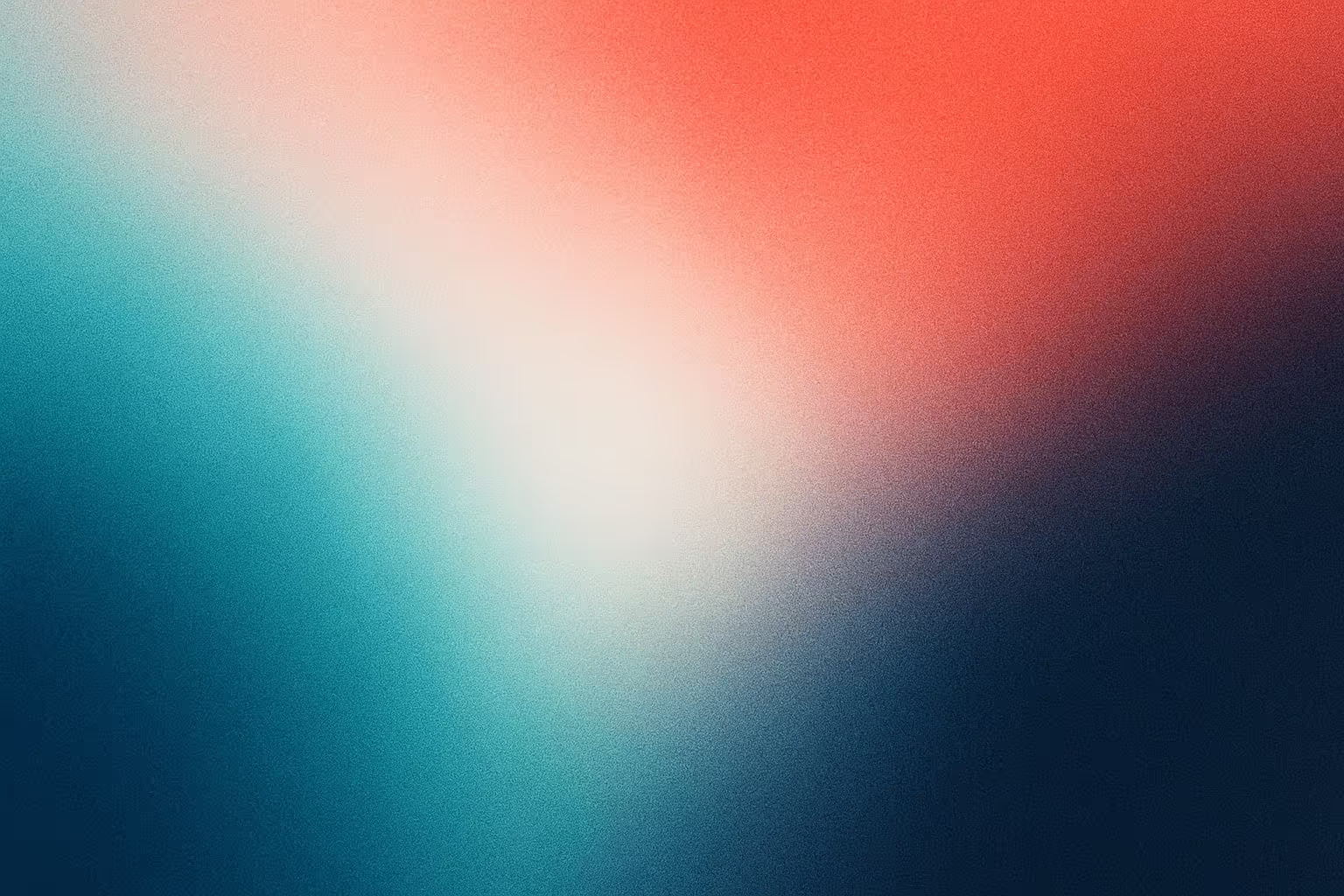
Teile den Artikel: